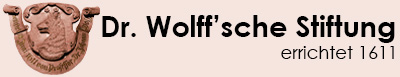Seit mehr als 400 Jahren für Mitmenschlichkeit und Fürsorge in der Altenhilfe.
Geschichtliches
Der landgräfliche Leibarzt und Professor der Medizin Dr. Johann Wolff hat durch testamentarische Verfügung im Jahre 1611 die nach ihm benannte Stiftung errichtet. In die Stiftung brachte Dr. Wolff u. a. seinen halben Anteil am Rittergut Ockershausen ein. Umfangreicher Landbesitz und daraus resultierende Einkünfte sind bis heute das wirtschaftliche Rückgrat der Stiftung.
Zunächst bestand die Stiftung aus einem "Hospital" genannten Gebäude, worunter man damals kein Krankenhaus, sondern ein Wohnheim verstand.
Hier sollten acht alte Menschen aus Marburg und Ockershausen als "Pfründner" einen würdigen Lebensabend verbringen. Die Stiftung war, dem Willen des Stifters entsprechend, einem protestantischen Arbeitsethos verpflichtet. Sie nahm nur Menschen auf, die in gutem Ruf standen und durch Schicksalsschläge arm geworden waren. Solange ihre Kräfte ausreichten, sollten die "Pfründner" auf dem Gut mitarbeiten. Sie erhielten eine gesunde, abwechslungsreiche Kost, die Dr. Wolff genau vorschrieb, und eine ärztliche Versorgung. Auch der Tagesablauf einschließlich der Zeiten für Gebet und Andacht war festgelegt.
Die Verwaltung oblag einem Zinsmeister, den die Wolff'schen Erben und Erbinnen und später deren Nachkommen ernannten. Männer und Frauen waren gleichberechtigt. Auch in Glaubensdingen war Dr. Wolff "modern". Die "Pfründner" mussten zwar evangelisch sein, aber ob sie Lutheraner oder Calvinisten waren, spielte keine Rolle, obwohl sich die beiderseitigen Theologen damals heftig bekämpften.
Das "Hospital" bestand als Vollversorgungseinrichtung für acht Männer und Frauen bis 1945. Statt der Naturalverpflegung erhielten die "Pfründner" aber seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Geld. Die wirtschaftliche Grundlage blieb der Grundbesitz, der laut Testament nicht vermindert werden durfte. Auch andere Stiftungen hatten eine solche Vorschrift, aber man hielt sich oft nicht daran, so dass das Vermögen dahinschwand. Nicht so bei der Dr. Wolff'schen Stiftung. Wenn in Kriegs- und Krisenzeiten die Erträge nicht ausreichten, hat man die Zahl der "Pfründner" verringert, den Grundbesitz aber erhalten.
In der Zeit des Nationalsozialismus (1933 bis 1945) war der Grundbesitz stark gefährdet. Landwirtschaftlicher Besitz sollte nur in Bauernhand sein, und Stiftungen sollten ihre Ländereien eigentlich bis 1941 an Bauern verkaufen. Da der Kriegsausbruch dazwischenkam, wurde die Frist bis 1948 verlängert. Dann galt dieses Gesetz nicht mehr. Die Wirren der Kriegszeit, in der viele Stiftungen in den Besitz der Kommunen übergingen, hätten beinahe das Ende der Stiftung gebracht, wenn nicht ein tatkräftiger Zinsmeister sie erhalten und in eine neue Rechtsform überführt hätte.
Die Bewirtschaftung des Stiftungslandes wurde seit der Gründung ständig modernisiert. Schon im 17. Jahrhundert ging man an die Verpachtung an örtliche Bauern über. Seit den 1950-er Jahren wurden die bis dahin rein landwirtschaftlich genutzten Grundstücke an Bauherren und Gewerbebetriebe auf Erbpachtbasis vergeben.
Dank gestiegener Einkünfte konnte die Stiftung Ende des 19. Jahrhunderts die andere Hälfte des oben erwähnten Gutes dazukaufen. Und 1913 konnte sie das baufällig gewordene alte Gutshaus durch einen größeren Neubau ersetzen, der noch heute ein Schmuckstück ist (Stiftstraße 25, wo sich auch die Verwaltung der Stiftung befindet).
Der Neubau von 1913 hatte 15 Kleinwohnungen, von denen 7 preiswert vermietet wurden. Das Nebeneinander von 8 bezahlten "Pfründnern" und 7 zahlenden Mietern wurde nach 1945 beendet. Die Stiftung stellt seitdem nur noch subventionierten Wohnraum zur Verfügung. Dieser wurde seit den 1960-er Jahren durch 4 Neubauten im Bachweg erheblich vermehrt, so dass die Stiftung heute über 100 Senioren und Seniorinnen beherbergt.
Neben der Altenstiftung gründete Dr. Wolff mit dem Testament von 1611 auch eine Stipendienstiftung, die er mit Kapitalvermögen ausstattete.
Aus den jährlichen Zinserträgen unterstützte sie zwei bis vier evangelische bedürftige Studenten, bis sie in der Inflation von 1923 ihr Kapital verlor. Seit den 1960-er Jahren aber hat die Stiftung die Stipendienvergabe wiederbelebt. Heutzutage werden jährlich bis zu 10 bedürftige Studenten und Studentinnen mit unterschiedlich hohen Beträgen unterstützt, darunter auch Ausländer. Die Entscheidung fällt ein Ausschuss ("Sonderkuratorium"), dem Vertreter der Stiftung, der Professorenschaft und des ASTA angehören.
Wenn Sie mehr wissen wollen, lesen Sie die gedruckte Geschichte der Stiftung aus der Feder des Marburger Historikers Professor Dr. Günter Hollenberg, "Die Stiftung Dr. Johann Wolffs in Marburg 1611 bis 2011", Marburg 2011, 144 Seiten, 31 Abbildungen, gebunden, 10 Euro. Das Buch ist erhältlich bei der Dr. Wolff'schen Stiftung, Stiftstraße 25,35037 Marburg.
Das Wolff´sche Wappen

Unser Haupthaus
um 1800